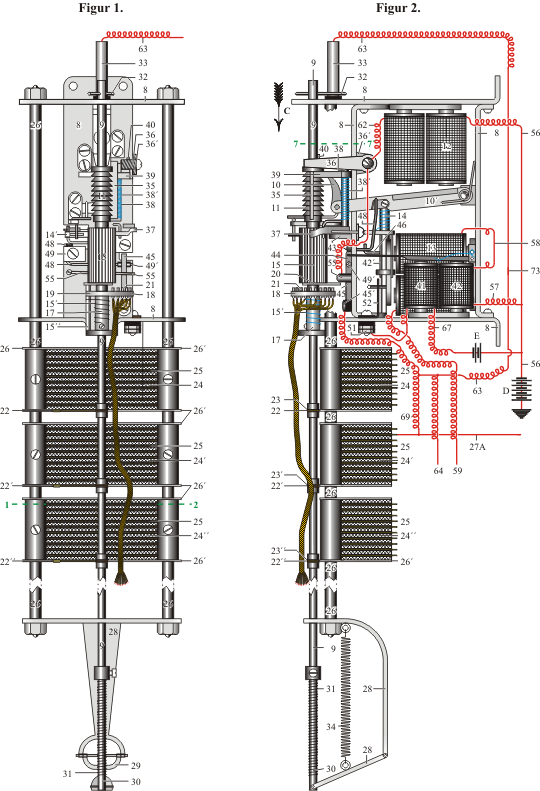
| Patentnummer: | 638.249 |
| Bezeichnung: | Elektrical Exchange |
| aufgegeben am: | 16. 12. 1895 |
| erteilt am: | 05. 12. 1899 |
| Patentnehmer: | Alexander E. Keith, Chicago, Illinoise, |
| John Erickson, Chicago, Illinoise, | |
| Charles J. Erickson, Chicago, Illinoise, | |
| Firma: | Mitarbeiter der Strowger Telephone Exchange, Chicago, Illinoise |
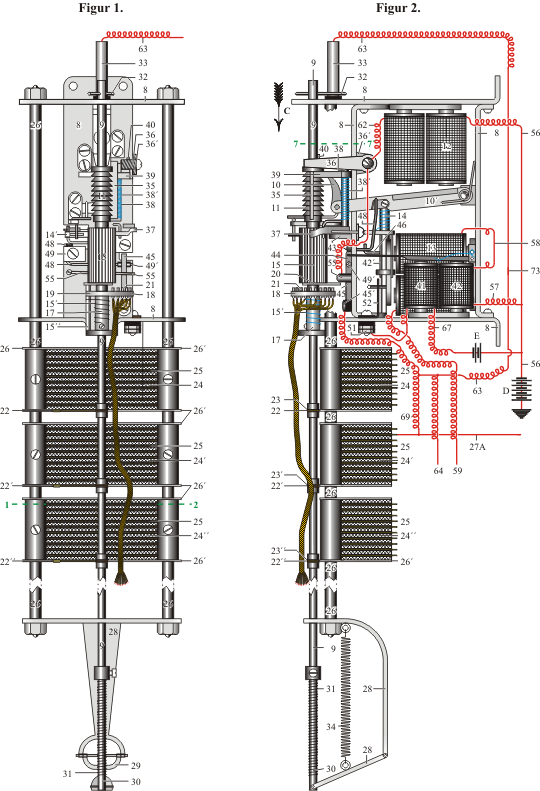
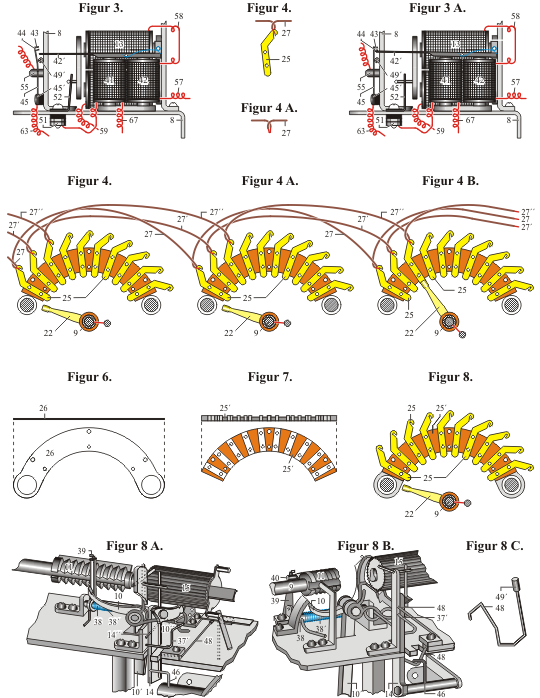
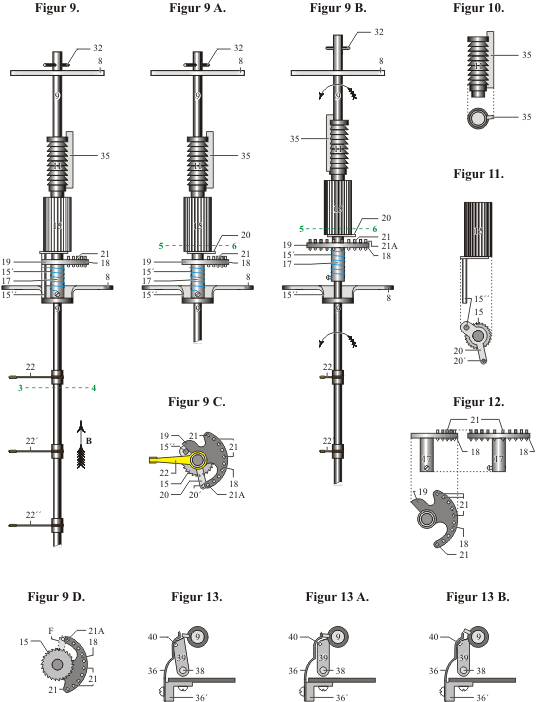
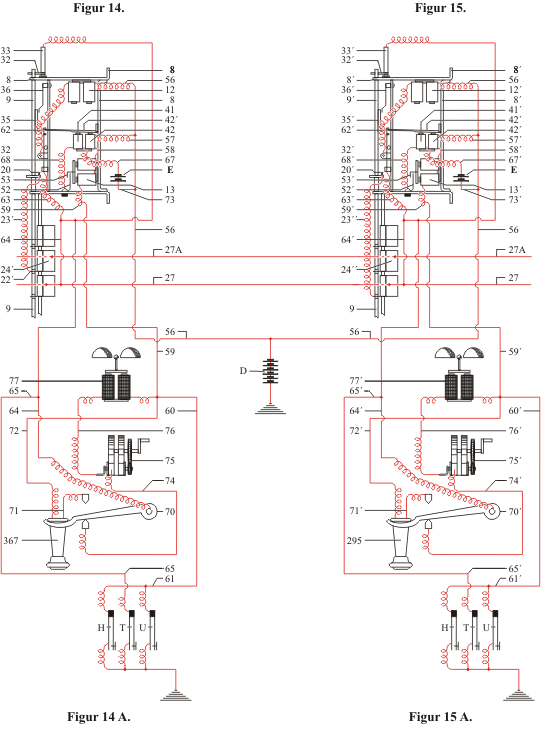
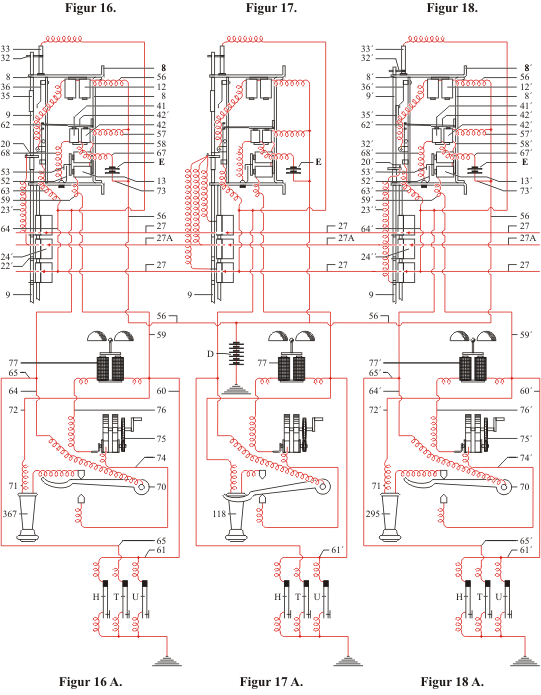
Der direkte Vorläufer der in Deutschland erstmals eingesetzten Wähler, das
von den Brüdern John und Charles Erickson und Keith entwickelte Schaltwerk.
John und Charles Erickson nahmen zwar schon längere Zeit Einfluss auf die
Entwicklung. Doch nun lernten sie aus den Erfahrungen und den Anforderungen
für die Zukunft. Das größte Problem war, die Kapazität zu erhöhen. Sie kamen
schnell zu der Erkenntnis, dass es hierzu nötig wäre, mehrere parallel
verlaufende Verbin-dungen über die Schaltwelle zu realisieren, und diese zu
verlängern. Also musste eine andere Form der Kontaktbank entwickelt werden.
Doch schon bei einer Kapazität für einige Hundert von Teilnehmern würde die
Schaltwelle unzulässig lang werden. Doch es könnten infolge der Drehbewegung
der Schaltwelle 10 verschiedene Teilnehmer erreicht werden.
Am 16. Dezember
1895, nach dem Ausscheiden Almon B. Strowgers, meldeten Keith und die Brüder
Erickson ihr neues Schaltwerk unter der Seriennummer 572331 zum Patent an. Am
05. Dezember 1899 wurde es ihnen erteilt.
Nachfolgend eine kurze Beschreibung dieses Patents:
Die neue Bauform des Schaltwerks wird in den Figuren 1 in Vorderansicht und in
Figur 2 in Seitenansicht gezeigt. Die neue Kontaktbankform ist in den Figuren
4 bis 8 zu sehen. Die Kontaktbänke bestanden aus mehreren Kontaktreihen, von
denen jede zehn Messingstanzstücke enthielt, die auf Isolierstücken
aufgesteckt waren. Die Isolierstücke bestanden aus Elektrose (Isolator aus
bruchsicherem Kunststoff), einem Material, das den bisher in der
Elektrotechnik verwendeten Hartgummi er-setzte. Die Stanzstücke verfügten an
ihrem äußeren Ende über einen Haken, in den der Vielfachdraht eingehängt
werden konnte. Zehn Kontaktreihen wurden zu einer Kontaktbank zusammengefasst
und in einen Rahmen eingeklemmt.
Der Kontaktarm war nun für das Schleifen
über ein Kontaktfeld eingerichtet, aber ansonsten den älteren Ausführungen
sehr ähnlich. Die Einteilung der Kontaktbänke erfolgte in Gruppen und es
wurden mehrere Kontaktarme, die über einen Hilfs-schalter vom Teilnehmer
ausgewählt werden konnten, auf der Schaltwelle vorgese-hen. Das Schaltwerk
wurde von nun an senkrecht montiert, so dass wir ab jetzt von einer Heb- und
einer Drehbewegung sprechen können - der Heb-Dreh-Wähler ward geboren. Führte
das Schaltwerk zum Beispiel vier Hebeschritte und 3 Drehschritte aus,
kontaktierte der Kontaktarm die Nummer 43 des betreffenden Hunderts. Waren,
wie in unserem Beispiel, drei Bankkontaktgruppen vorhanden, konnte sich der
Teilnehmer mit den entsprechenden Kontaktarmen mit der Leitung 143, 243 oder
343 in Verbindung setzen.
Die Funktionen der Zahnzylinder 11 und 15, in
den Figuren 9.., für die Hebe- und Drehbewegung wurden erweitert. In den
Figuren 9.. ist 15 der Drehzylinder. Er sitzt lose auf der Schaltwelle und ist
mit einem nach unten gerichteten Stift 15´´ ausge-rüstet. Fest mit der
Schaltwelle 9 verbunden ist der Hilfsschalter 18 während die Vorrichtung 17,
die ebenfalls fest mit der Schaltwelle verbunden ist, mit dem Stift 15´´
gekuppelt ist. Die unten angeordneten Kontaktarme 22, 22´ und 22´´ sind mit je
einem Metallstift 21, die kreisförmig angeordnet auf dem aus Isoliermaterial
be-stehenden Korpus des Schalters 18 angeordnet sind, verbunden. Am
Drehzylinder 15 ist ein Arm 20 mit einer Bohrung am Ende befestigt.
Die
Wirkungsweise des Schaltwerks:
Wird der Drehmagnet von Strom durchflossen,
dreht er nicht die Welle um einen Zahn, sondern nur den Drehzylinder 15 und
seinen mit ihm verbundenen Arm 20. Am Ende der ersten Impulsserie kommt so das
Loch im Arm 20 über dem der An-zahl der Impulse entsprechenden Stift des
Hilfsschalters 18 zum stehen. Folgt jetzt die Hebebewegung, gleitet der Stift
in das Loch hinein und neben der mechanischen Kopplung zwischen Schaltwelle
und Drehzylinder wird eine elektrische Verbin-dung zwischen der Schaltwelle 9
und einem der Kontaktarme wird hergestellt. Stromimpulse für eine Drehbewegung
können so die Schaltwelle mit dem Drehzylinder bis zu dem gewünschten Kontakt
drehen.
Die Auslösung:
Sie ist
im wesentlich der des früheren Systems ähnlich und bedingt ein kompliziertes
mechanisches Zusammenwirken der Hebe- und Drehmagnete. Auch hier bilden die
Sperrklinken des Dreh- und Hebezylinders eine gemeinsame Einheit.
Aldendorf
schreibt zur weiteren Funktion folgendes:
In der Ruhestellung wurden sie
durch den Drehmagneten von den Zahnzylindern abgehoben, aber, sobald dieser
seine erste Bewegung ausführte, griffen sie in die Fortschaltzähne ein. Bei
der Auslösung wurde der Drehmagnet zuerst betätigt, wobei er einen Stift in
die Bahn eines auf der Fortschaltklinke für die Hebebe-wegung angebrachten
Schwanzstückes brachte. Indem hierbei der Drehmagnet in seiner angezogenen
Lage gehalten wurde, wurde jetzt der Hebemagnet betätigt, wobei das eben
genannte Schwanzstück hoch ging und die Sperrklinken aus den Zahnzylindern
heraushob. Darauf wurde der Drehmagnet losgelassen, wobei er seinen
vorgenannten Stift über einen mit den Sperrklinken verbundenen Hebel egte, so
dass diese in ihrer herausgehobenen Lage festgehalten wurden. Schliesslich
wurde der Hebemagnet losgelassen. Um eine klarere Vorstellung der allgemeinen
Wirkungsweise des Schaltwerkes zu gewinnen, wenden wir uns der Schaltung Fig.
15 zu, in welcher die Stromläufe eines Wählers und der damit verbundenen
Teilnehmer-station dargestellt sind. Letztere kann irgend ein Induktorapparat
sein, der mit denselben Drucktasten ausgerüstet ist, die bei dem Saitensystem
benutzt wurden.
Der Hakenumschalter ist so eingerichtet, dass er bei seiner
Abwärtsbewegung die Leitungen erdet, öffnet und schließt, um damit die
Auslösung zu bewirken.
Die Hebeleitung ist mit dem Körper des Wählers an
zwei Stellen verbunden, einmal durch Feder 45 und Anker 42'; andererseits
durch den Arbeitsschalter 32. Die für ankommende Anrufe bestimmte eigene
Leitung des Schaltwerkes bildet eine Abzweigung der Hebeleitung und ist an die
Kontaktbänke geführt. Bei 36 befindet sich ein Nebenschalter einfacher Art,
welcher zum Ein- und Ausschalten des Hebemag-neten dient. 35 ist ein
Metallstreifen, welcher sich der Feder 36 gegenüber befindet, solange die
Welle 9 noch nicht gedreht worden ist. Feder 36 wird in der Ruhelage von 35
durch den Hebel 40 abgehoben, welcher durch die Sperrklinken betätigt wird.
Bei 18 befindet sich der Hilfsschalter, dessen Konstruktion und Wirkungsweise
bereits
beschrieben ist. Die Drehleitung durchläuft den Drehmagneten und
den Magneten 42 und endet dann an dem Minuspol der Batterie B; diese ist die
Hauptbatterie, deren Pluspol geerdet ist. Ihr negativer Pol ist mit einer
Leitung verbunden, welche die gemeinsame Rückleitung im Amte bildet. Durch
diese gemeinsame Rückleitung fliessen alle Läute- und Sprechströme sämtlicher
Leitungen, die hier alle untereinander verbunden sind. Der Drehmagnet besorgt
nicht nur die Drehung des Hilfsschalters und der Kontaktarme, es sind ihm
vielmehr auch noch andere wichtige
Funktionen, welche mit der
Geheimschaltung zusammenhängen, zugeteilt. In der Darstellung hat er zwei
Anker, obwohl er in Wirklichkeit nur einen besitzt. Die beiden Magnete 41 und
42 betätigen den gemeinsamen Anker 42'. In der Ruhestellung ruht Letzterer
gegen den Anschlag 43, der sich auf der Feder 45 befindet, und stellt eine
elektrische Verbindung mit ihm her. Wenn Magnet 42 betätigt wird, zieht er 42'
gegen
den isolierten Anschlag 44. Der Drehmagnet bewegt 45 durch den
isolierten Anker 49. Da der Drehmagnet seinen Strom über den Magneten 42
erhält, wird der Anker 42' bei jedem Impuls heruntergezogen und gleichzeitig
die Feder 45 nach links gegen den Kontakt 55 gedrückt. Ehe der Drehmagnet auf
die Feder 45 einwirkt, schliesst er den Kontakt 52 - 53. Beim Loslassen des
Drehmagneten wird Kontakt 52 - 53 geöff-net.
Will nun ein Teilnehmer einen
anderen anrufen, dann wird zuerst der Hunderterknopf H entsprechend oft
heruntergedrückt; hierdurch wird die Drehleitung geerdet und der Drehmagnet
und Magnet 42 betätigt. Die erste Bewegung des Drehmagneten löst die
Sperrklinken aus, welch das Zurückschnellen der Schaltwelle bei der Hebe- und
Drehbewegung verhindern. Während die Sperrklinken herunterfallen, lassen sie
die Feder 36 mit dem Metallstreifen 35 Kontakt machen.
Die Zusammenwirkung des Drehmagneten und des Magneten 42 übt bis jetzt noch
keinen Einfluss aus, und der Drehmagnet bewegt nur den Hilfsschalter 18 bis zu
dem Stift 21, welcher dem gewünschten Hundert entspricht.
Beim betätigen
des Zehnerknopfes Z wird der Hebemagnet durch einen Strom erregt, der den
folgenden Weg nimmt: Von der Erde bei der Teilnehmerstation über die
Hebeleitung nach dem Arbeitsschalter 32, durch Welle 9, Metallstreifen 35 nach
Feder 36, dann nach dem Hebemagneten, Batterie B und Erde. Bei der nun
erfolgenden ersten Aufwärtsbewegung der Schaltwelle wird diese mit dem
Drehzylinder 15, in der früher beschriebenen Weise gekuppelt.
Durch
Niederdrücken des Einerknopfes E wird nun die Drehleitung geerdet und der
Drehmagnet betätigt, der die Welle mit den Kontaktarmen herum dreht. Durch die
erste Drehbewegung der Welle wird der Arbeitsschalter 32 geöffnet, ebenso der
Kontakt der Feder 36 mit 35. Während der Kontaktarm, mit welchem der
Hilfsschalter die Verbindung hergestellt hat, bis zu der gewünschten Nummer
herumgedreht wird, streift er über alle dazwischen liegende Bankkontakte
anderer Teilnehmerleitungen hinweg. So oft der Drehmagnet anzieht, verbindet
er den Magneten 41 durch den Kontakt 52 - 53 mit dem Kontaktarm. Es ist dann
ein Stromweg geschaffen von der Batterie E1 durch Magnet 41, Kontakt 52 - 53,
Körper 8, Hilfsschalter, Kontaktarm, Bankkontakte der anderen
Teilnehmerleitungen, über welche der Kontaktarm hinweggleitet, über die
Hebeleitungen nach den Teilnehmerapparaten, Drehleitungen, zurück nach der
gemeinsamen Leitung im Amte, welche mit dem andern Pol der Batterie B
verbunden ist. Wenn auf den Leitungen, über deren Bankkontakte der Kontaktarm
gleitet, nicht gesprochen wird, dann wird der eben genannte Strom
nach-einander die Wecker der betreffenden Stationen durchfließen müssen. Die
Wecker haben einen Widerstand von 1000 Ohm, so dass der Magnet 41 einen so
schwachen Strom erhält, dass er den durch Magnet 42 bereits angezogenen Anker
421 nicht halten kann. Wenn jedoch eine Leitung gerade benutzt wird, dann wird
der niedrige Widerstand des Sprechapparates dem Magneten 41 ermöglichen, den
Anker 421 solange angezogen zu halten, bis der Drehmagnet die Feder 45 nach
rechts zurückkehren lässt. Au diese Weise wird der Anker 421 unter dem
Isolierstift 44 gefasst und festgehalten. Hierdurch wird die Hebeleitung an
der Feder 45 (Anschlag 43) geöffnet, so dass das Gespräch der bereits
sprechenden Teilnehmer nicht mitgehört werden kann. Wird der Kontaktarm zur
nächsten Leitung weiter bewegt, so wird, wenn diese unbesetzt ist, die Öffnung
der Hebeleitung wieder aufgehoben. Wenn die ge-wünschte Leitung unbesetzt
vorgefunden wird, dann ruft der die Verbindung herstel-lende Teilnehmer
mittels Induktors die andere Station an.
Aus dem Vorangegangenen geht
hervor, dass Feder 45 mit Anker 421 einen Prüfschalter bildet, und dass dieses
System Geheimsprechen gewährleistet.
Die Hauptmerkmale dieses Systems:
01. Nun haben wir eine moderne Kontaktbankform, richtungsweisend für die
Zukunft.
02. Der Einsatz von Vielfachdrähten führte zu einer
Kostenersparnis.
03. Über einen Hilfsschalter und eine Kupplung wird
zwischen Hunderter und Einerwahl umgeschaltet.
04. Einführung des
vollständigen Geheimsprechens.
Das zuvor beschriebene System ersetzte
im Juni des Jahres 1895 das Saitensystem in La Porte, Indiana. Im August des
gleichen Jahres wurde eine Einrichtung für 200 Teil-nehmer in Michigan City,
Indianer, aufgebaut.
Aber recht bald traten Schwierigkeiten mit den
Kontaktbänken auf. Die Elektrose, der Isolierstoff, dehnte sich aus oder
krümmte sich. Die Abstände zwischen den einzelnen Kontaktstanzstücken
veränderte sich und die Lage der Kontaktreihen war nicht mehr definiert. Es
kam logischer Weise zu Falschverbindungen.
Charles J. Erickson
konstruierte im November 1895 eine Kontaktbank aus Gips. Dazu entwarf er eine
Stahlform, in deren Inneren er die Messingkontaktstücke der einzelnen
Kontaktreihen fixierte. Dann wurde die Form mit Gips gefüllt und trocknen
lassen. Die Form wurde entfernt und die Kontaktbank in einem mäßig warmen Ofen
weiter getrocknet, bis alle Feuchtigkeit entwischen war. Um deren
Wiedereintritt zu ver-hindern wurde die Kontaktbank anschließend in Paraffin
gekocht, bis sie vollständig durchtränkt war. Durch vorsichtiges Schwabbeln
mit Walrosshaut wurden an-schließend die Kontakte gereinigt. Kontaktbänke
dieser Bauform wurden bis ca. 1902 genutzt. Die erste Vermittlungseinrichtung
mit derartigen Kontaktbänken soll bereits 1896 in Rochester mit einer
Kapazität von 200 Leitungen als Ersatz für das bestehende Saitensystem
aufgebaut.
Aber auch dieses System konnte die gestiegenen Anforderungen
hinsichtlich der Erhöhung der Kapazität nicht erfüllen. Es folgte eine erneute
Verbesserung des Systems, siehe Patent Nr. 672.942, angemeldet am 23. Juni
1897 unter der Seriennummer 641.889 und erteilt am 30. April 1901.